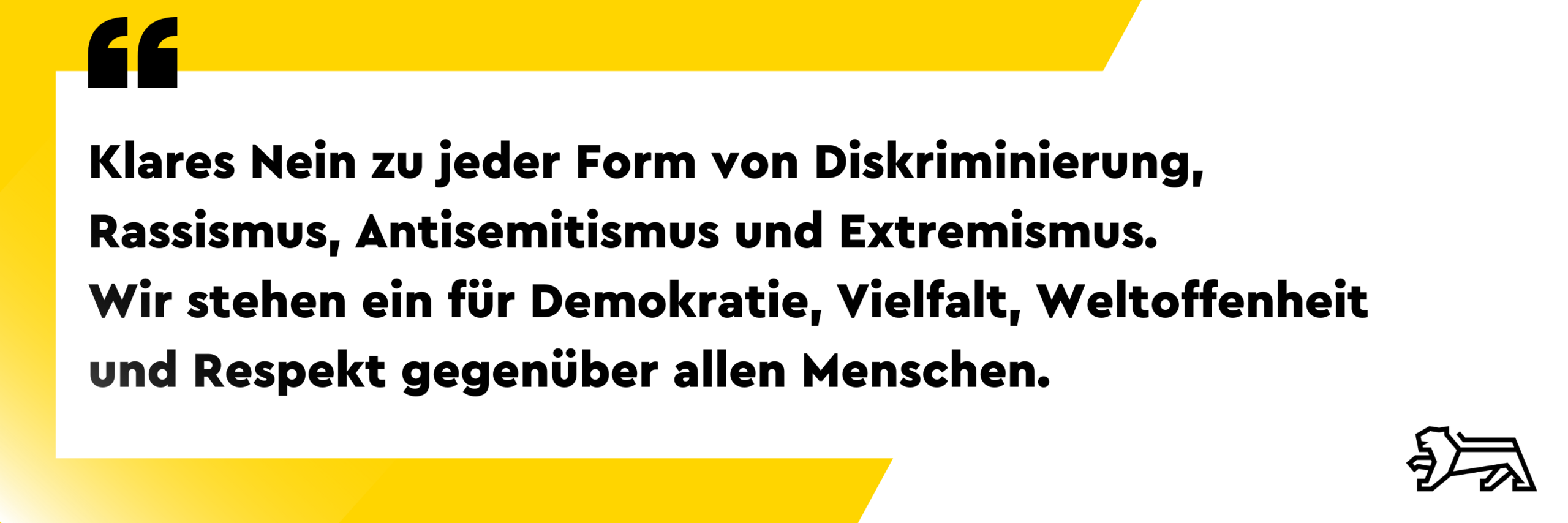Das Team erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Grafikdesign" für das Spiel "The Bear – A Story from the World of Gra".

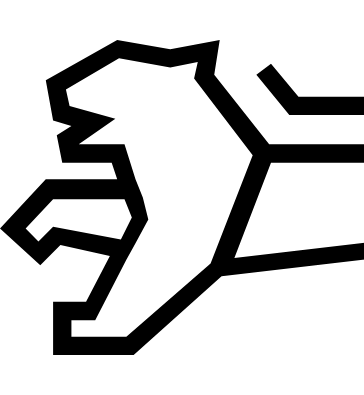
Mit passgenauen Programmen und Projekten unterstützt die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg in ihrem Geschäftsbereich MFG Kreativ die Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir beraten, fördern und vernetzen die Kreativen im Südwesten.
Im Kompetenzfeld Digitale Kultur der MFG Kreativ begleiten, beraten und coachen wir baden-württembergische Museen, Archive, Bibliotheken und Kunsthäuser im digitalen Wandel.